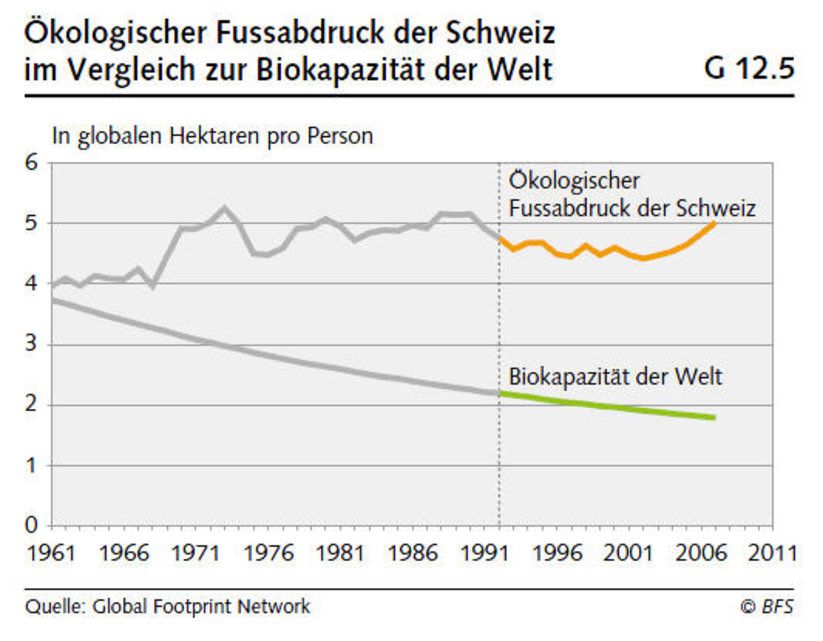Hammer und Meißel statt Füller und Schulheft: Tausende Kinder in Indien klopfen täglich unter extremen Bedingungen Pflastersteine zurecht. Mitverantwortlich dafür sind auch preisbewusste deutsche Käufer. Eine Spurensuche in zwei Welten.

Frank Oltersdorf fixiert den Laptop, dann wendet er sich von den Fotos ab und starrt aus seinem Fenster. "Nein", sagt der 54-Jährige, "so schlimm hatte ich das nicht erwartet." Sein Blick geht hinunter zur Havel und zu der neu angelegten Uferpromenade, über die er gerade so stolz gesprochen hat. Jetzt schweigt der Oranienburger Baudezernent. Arbeitende Kinder in Indien und idyllisches Kleinstadtpanorama vor der Haustür - bis vor wenigen Minuten war er sicher, dass dazwischen Welten liegen. Jetzt sind sie zusammengerückt. Sie prallen aufeinander im Büro eines brandenburgischen Verwaltungschefs, der seine Sätze damit beginnt, dass er sich nicht "rausreden wolle", eines Mannes, der zwar belegen kann, "strikt nach den vergaberechtlichen Vorgaben" gehandelt zu haben, der aber trotzdem ein "ungutes Gefühl" hat.
Dabei war Frank Oltersdorf so stolz, damals am 15. April 2009, als extra der Minister aus Potsdam anreiste, um den letzten Stein des neuen Schlossplatzes zu verlegen. Im Hintergrund erstrahlte in blütenreinem Weiß das barocke Stadtschloss, die 41.000 Einwohner große Kommune nördlich von Berlin hatte sich rausgeputzt für die Landesgartenschau, zu der im Sommer 600.000 Besucher anreisten. Was niemand ahnte: Wahrscheinlich waren es auch Kinder, die die 2000 Tonnen fein säuberlich verlegten Pflastersteine auf deutsches Einheitsmaß brachten.
Wer diesem Verdacht nachgehen will, muss zunächst rund 6000 Kilometer weit nach Osten reisen, in den indischen Bundesstaat Rajasthan. Der Oranienburger Granitstein stammt aus dem Süden des Landes, doch hier, im Norden, liegt das Zentrum der Pflastersteinproduktion. Die Bedingungen, unter denen die Arbeiter in der zerklüfteten Landschaft Steine hauen, sind typisch für die Branche.
Der graue Sandstein Kandla Grey, den man in Radschasthan findet, ist das Kapital von Männern, Frauen und Jungs wie Garju Lal, der in der Steppe am Boden kauert, in der rechten Hand einen abgenutzten Hammer, in der linken einen Meißel, den er an eine rechteckige Metallschablone anlegt. Es ist offensichtlich, dass er seit Jahren nichts anderes macht. Flink und mit maschinengleicher Präzision hämmert er hundertfach auf einen Steinbrocken ein. Dann wirft er den fertigen Pflasterstein auf den wachsenden Haufen neben ihm. Bei jedem Schlag wirbeln Steinsplitter durch die Luft, einen Mundschutz oder feste Schuhe trägt er nicht, es gibt auch keinen Schatten. Die Augen des Jungen schimmern glasig, ihm läuft die Nase, ockerfarbener Staub hat sich auf seinen tropfenden Rotz gelegt. Es ist ein feiner Staub, der sich täglich tiefer in die Lunge frisst.
Der verschüchterte Junge erzählt, dass er seine Pflastersteine wie alle hier an die Exporteure verkauft, die mit ihren Lkw kommen und die Steine einsammeln. Eine halbe Rupie verdient er pro Stein, weniger als zwei Cent. Wenn er fleißig ist, kommen am Abend 50 Rupien zusammen. Zum Vergleich: Drei Bananen kosten im nächsten Dorf 15 Rupien.
Jeder 20. Steineklopfer ein Kind
Kinderarbeit ist in Indien offiziell verboten. In der Region Radschasthan gehört sie trotzdem zum Straßenbild. Jeder 20. Steineklopfer, so die Schätzung eines Exporteurs, ist ein Kind, und viele haben ein ähnliches Schicksal wie Manoj aus der Kleinstadt Budhpura. Der zwölfjährige Junge lebt mit seinem jüngeren Bruder bei seiner Großmutter Shantibhai. Die Eltern der beiden, erzählt er mit kaum hörbarer Stimme, sind vor Jahren an der Lungenkrankheit Silikose gestorben, an der so viele hier zugrunde gehen. Weil die Großmutter zu schwach zum Arbeiten ist, müssen Manoj und sein Bruder täglich Steine klopfen. Der Verdienst reicht für die drei gerade so zum Überleben. "Wenn wir mal krank sind, hungern wir", sagt er. Eigentlich stehe ihnen eine Waisenrente zu, doch das Geld sei nie bei ihnen angekommen, sondern in der Tasche irgendeines Beamten gelandet. "Was sollen wir dagegen tun?", klagt die Großmutter.
Um sie herum scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Die Familie haust in einer mittelalterlich anmutenden Steinhütte, das Dach ist von etlichen Rissen durchzogen. In der letzten Regenzeit stand der modrig riechende Innenraum, in dem alle schlafen, kochen und essen, unter Wasser. Als Kleiderschrank dient ihnen ein schmaler Reisekoffer. Eine einfache Liege, ein klappriges Fahrrad und einen winzigen Fernseher, mehr besitzen sie nicht.
Rajnath kennt die Schicksale von Kindern wie Manoj und Garju Lal. Der Inder mit der gedrungenen Statur arbeitet für Xertifix, eine deutsche Zertifizierungsorganisation, die vom Misereor-Kinder-Rechtsexperten Benjamin Pütter gegründet wurde und unter anderem von dem ehemaligen Arbeitsminister
Norbert Blüm unterstützt wird. Rajnath ist einer von zwei einheimischen Kontrolleuren, die im Auftrag deutscher Steinhändler die Lieferkette bis in den Steinbruch zurückverfolgen. Er stattet 80 indischen Steinbrüchen regelmäßig unangekündigt Besuche ab: Beschäftigt der Betrieb Kinder? Werden faire Löhne gezahlt? Gibt es genügend Pausen für die Arbeiter? Wenn sich alle Zulieferer an die Regeln halten, bekommt der deutsche Steinhändler das Xertifix-Siegel und zahlt dafür drei Prozent des Einfuhrpreises an die Organisation.
Die Lebenserwartung: Knapp 40 Jahre
Doch die Kontrollen allein ändern nicht die Lebensbedingungen der Menschen, das wissen Xertifix und Kontrolleur Rajnath. Deshalb nimmt der 36-Jährige auch korrupte Beamte und Politiker ins Visier. Vor drei Jahren zog er, begleitet von mehreren hundert Kinderarbeitern, zum Palast des Premierministers und verschwand erst, als der Regierungschef ihn persönlich anhörte. Im Dorf Budhpura, wo Manoj und seine Großmutter wohnen, fordert er von den Lokalpolitikern seit Jahren, dass Kinder in die Schule statt in den Steinbruch gehören und kranke Menschen medizinische Versorgung bekommen.
Einige Dinge hätten sich bereits verbessert, sagt er, in der staatlichen Schule sitzen von den 56 angemeldeten Kindern heute immerhin 35 im Klassenraum. Auch in der Krankenstation, einem kleinen Häuschen, das in den vergangenen Jahren meist zugesperrt war, herrscht Betrieb. Patienten warten vor der Tür, im Behandlungszimmer gibt ein junger Arzt einem Greis eine Spritze in den Arm, hinter ihm stapeln sich in einem Regal 31 Schuhkartons - in jedem die Krankengeschichte eines Patienten, der an der Lungenkrankheit Silikose leidet. Die Lebenserwartung junger Steineklopfer: "Knapp 40 Jahre", sagt der Arzt.
Rajnath sind die Fortschritte zu klein. Deshalb hat er am Abend ein Treffen mit dem Mann vereinbart, der in dieser Gegend die Fäden zieht: Mitten in einem Park, in dem das Zirpen der Grillen den Lärm der Millionenstadt übertönt, residiert Ijyaraj Singh, der Nachfahre des Maharadschas. Die Wände zieren historische Kriegsgemälde, ein Marmorsockel trägt ein gerahmtes Bild, das Singhs Vater mit dem ehemaligen französischen Staatschef Valéry Giscard d'Estaing zeigt. Die Vorfahren des Adligen haben über die Region geherrscht, Singh sitzt als Abgeordneter im Parlament von Delhi.
In akzentfreiem Englisch zählt der 45-Jährige die vielen Programme und Gesetze auf, die die Politik in den vergangenen Jahren gegen Kinderarbeit und für flächendeckende Schulbildung erlassen hat. Rajnath hört zu, hakt dann aber entschieden nach: "Ich habe in Budhpura wieder Kinder gesehen, die für einen Hungerlohn schuften, statt zur Schule zu gehen." Der Abgeordnete gesteht: "Bei der Umsetzung unserer Gesetze gibt es große Schwierigkeiten." Es fließe zwar genügend Geld, zu viel versickere aber in den korrupten Strukturen.
Rajnath sagt, dass man Kinderarbeit nicht einfach verbieten könne, man müsse den Menschen Unterstützung geben, damit sie eine Alternative zur Arbeit haben. Der Maharadscha nickt und stimmt einer öffentlichen Anhörung zu: Die Kinder sollen von ihrem Schicksal berichten, die lokalen Politiker müssen sich rechtfertigen und erklären, warum Manojs Großmutter keine Rente bekommt oder wieso nicht alle Kinder in die Schule gehen und dort eine warme Mahlzeit erhalten. Auf der Rückfahrt klopft sich Rajnath im Auto zufrieden auf den Oberschenkel. In seinem endlosen Kampf hat er einen weiteren Sieg errungen.
12,6 Millionen Kinder arbeiten - offiziell
Wie klein der allerdings ist, ahnt man bei einem Besuch der staatlichen Arbeitsbehörde. "Kinderarbeit? Nicht mein Thema", sagt Santosh Prasad Sharma und gibt sich kurz angebunden. Sharma, gestutzter Schnauzbart, frisch gebügeltes Hemd, leitet die Behörde. Er ist dafür zuständig, dass Unternehmen in den Regionen rund um die Millionenstadt Kota im Norden Indiens keine Kinder beschäftigen und fair mit ihren Angestellten umgehen.
Sharma zerrt ausgefüllte Fragebögen aus einem vergilbenden Aktenstapel. Seine Mitarbeiter seien mit einer großen Befragung zu den Arbeitsbedingungen beschäftigt, erklärt er, demnächst sollen die Ergebnisse vorliegen. Und was passiert dann? "Dann starten wir die nächste Befragung." Für die Kontrollen der Unternehmen sind fünf Beamte zuständig. Drei von ihnen sitzen an diesem Tag zufällig in ihren Büros, anstatt Betriebe zu inspizieren. "Die Behörde stellt uns keine Autos zur Verfügung", erklärt einer. Wie sie in oft unwegsamem Gelände zu den Firmen kommen, das müssten sie selbst sehen.
Produzenten und Exporteure, die Kinder beschäftigen wollen, haben leichtes Spiel. Zwar erließ der Staat 2009 den "Right to Education Act", ein Gesetz, das allen 6- bis 14-Jährigen einen Schulplatz garantiert. Nach Meinung vieler Experten ist es aber gerade in armen Regionen kaum mehr als eine Absichtserklärung. Auch das milliardenschwere "National Child Labour Project", das die Ausbeutung der Ärmsten verhindern soll, ist nahezu wirkungslos. Dem Staat gelingt es seit Jahrzehnten nicht, die Zahl der arbeitenden Kinder zu reduzieren. Offiziell sind es 12,6 Millionen. Kinderschützer gehen davon aus, dass es weit mehr gibt.
Beste Konditionen für westliche Händler
Doch es sind nicht die indischen Produzenten, Politiker und Beamten allein, die dafür sorgen, dass Millionen Kinder weder eine Kindheit noch eine Zukunft haben. Auch westliche Händler, Häuslebauer und Baudezernenten tragen Schuld an dem Leid. Ein Exporteur, der anonym bleiben will, sagt: "Ohne Kinderarbeit lassen sich die Pflastersteine gar nicht zu den Konditionen herstellen, die europäische und deutsche Käufer vorgeben."
Laut Statistischem Bundesamt führten deutsche Unternehmen im Jahr 2010 mehr als 600.000 Tonnen Pflastersteine aus aller Welt ein. Mehr als die Hälfte der Steine stammt aus China, dem weltweit führenden Natursteinproduzenten. Die Importe aus dem Riesenreich gelten mit Blick auf Kinderarbeit als vergleichsweise unbedenklich. Doch gleich nach Portugal, der Türkei und den Niederlanden folgt Indien auf Rang fünf. Fast 30.000 Tonnen wurden 2010 direkt vom Subkontinent geliefert, tatsächlich verbaut wurden wohl noch mehr Steine, da viele Ladungen mit dem Schiff in den Niederlanden ankommen und von dort über die Grenze gebracht werden. Das Xertifix-Siegel tragen nach Angaben der Organisation weniger als zwei Prozent dieser Importe.
Nicht zertifizierte Steine landen bei Online-Händlern wie M.C. Stone. Das Bielefelder Unternehmen preist den nordindischen Pflasterstein Kandla Grey auf seiner Homepage als "Bestseller" an, der "wunderbar in eine grüne und blühende Gartenlandschaft" passe. Ein Zertifikat könne man nicht vorlegen, erklärt M.C. Stone seinen Kunden, der indische Zulieferer bescheinige jedoch, dass die Steine ohne Kinderarbeit hergestellt wurden. Eine offizielle Presseanfrage ließ der Geschäftsführer unbeantwortet.
Ein Quadratmeter des Pflastersteins - frostbeständig, Oberfläche: spaltrau, lieferbar in den Größen 9 mal 9 oder 14 mal 14 Zentimeter - kostet bei dem Internethändler 34,20 Euro. Weniger als ein Drittel davon erhält in der Regel der indische Exporteur, der wiederum nur etwa acht bis zehn Prozent seiner Einnahmen an die Mitarbeiter auszahle, rechnet ein Branchenkenner vor. Bei den Steineklopfern in Indien käme so weniger als ein Euro pro Quadratmeter an.
Der Druck der Konsumenten ist sehr gering
Dass das Gros der indischen Steine das Land ohne anerkannte Zertifizierung verlässt, liegt nicht nur an Unternehmen wie M.C. Stone. Auch Privatkunden, die zum Beispiel ihre Auffahrt neu pflastern, achten zu selten darauf. Der Druck der Konsumenten ist sehr gering, berichten Steinhändler. Nur wer bei öffentlichen Aufträgen mitbietet, müsse sich in der Regel um eine Zertifizierung bemühen.
Zudem fehlt für eine seriöse Zertifizierung im großen Maßstab die Infrastruktur: Organisationen, die wie Xertifix unangekündigt kontrollieren und die Lieferkette bis in den Steinbruch verfolgen, lassen sich an einer Hand abzählen. Ein länderübergreifendes und international anerkanntes Label gibt es nicht, ein runder Tisch mehrerer internationaler Initiativen unter Leitung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat noch keine verbindlichen Ergebnisse hervorgebracht. Und die holländische Working Group on Sustainable Natural Stone (WGDN), in der sich Steinimporteure und Nichtregierungsorganisationen aus mehreren europäischen Ländern zusammengeschlossen haben, um ein wirksames Zertifikat zu kreieren, entsteht gerade erst.
Hundertprozentige Sicherheit wird aber auch dieses Siegel nicht garantieren können. Vor allem bei den Pflastersteinen funktioniert die Branche in Indien so informell und unübersichtlich, dass sich kaum jeder Schritt kontrollieren lässt, bis die Steine in Deutschland ankommen: Häufig sitzen die arbeitenden Kinder einfach irgendwo am Straßenrand, und kein Kontrolleur und kein Zertifizierer kann auf der Suche nach ihnen die Pisten des Landes abfahren.
Man müsse ertragsorientiert arbeiten, heißt es bei einer Firma
Sollten Händler indische Steine deshalb aus dem Sortiment nehmen? Die Stonepark GmbH aus Diepholz, die Steine aus der ganzen Welt importiert, behält sie weiter im Angebot - ganz bewusst, wie ein leitender Mitarbeiter betont. Das Unternehmen nehme das Thema Kinderarbeit und die Arbeitsbedingungen nicht auf die leichte Schulter, sagt er, für seine Importe aus China führt es ein Siegel, das in der Branche als vorbildlich gilt. Seine indischen Steine bezieht das Unternehmen, das nach eigenen Angaben drei bis vier Millionen Euro Umsatz macht, zum Teil von Zulieferern mit Xertifix-Zertifikat.
Aber: Wie alle Unternehmen müsse man ertragsorientiert arbeiten. "Umso schwieriger ist es für uns, unsere Produkte in Bezug auf die Kinderarbeit auszuwählen. Der Endkunde sollte bei seiner Kaufentscheidung auf diesen Aspekt achten und gegebenenfalls auf diese Thematik gesondert eingehen", sagt der Mitarbeiter. Auch das Xertifix-Siegel biete keine hundertprozentige Sicherheit. Deshalb würde man seine Kunden über die Kinderarbeitsproblematik aufklären: Manche würden dann bewusst indische Steine wählen, im Glauben, dadurch die Arbeiter und auch Kinder zu unterstützen, andere würden sich gegen die Steine entscheiden.
Frank Oltersdorf, der Baudezernent in Oranienburg, ist einer der Kunden der Stonepark GmbH. Er streitet ab, dass ihn das Unternehmen auf die Gefahr von Kinderarbeit aufmerksam gemacht habe, damals, als seine Kommune 2000 Tonnen südindischen Granit-Pflasterstein orderte. Gewarnt war Oltersdorf. Ein Fernsehbeitrag der ARD hatte im Vorjahr ausführlich über die Problematik berichtet und aufgedeckt, dass unter anderem die Steine auf dem Kölner Heumarkt von Zulieferern stammen, die indische Kinder für sich arbeiten lassen. "Es gab wegen des Films ein paar Nachfragen aus der Politik, wir haben deshalb eine Bescheinigung angefordert", sagt Oltersdorf und kramt aus einer roten Plastikmappe, in der er die Unterlagen von damals archiviert hat, eine Selbstbescheinigung des norddeutschen Stonepark-Zulieferers hervor, in der er sich selbst "hohe ethische Ansprüche" auf die Fahnen schreibt, sowie ein "Certificate".
Das dreizeilige Schreiben bestätigt dem indischen Hersteller, dass er keine Kinder beschäftigt. Unterschrieben hat es ein Beamter einer südindischen Arbeitsbehörde im Jahr 2006. Eine Arbeitsbehörde, wahrscheinlich eine wie in Kota, in der sich die Beamten in ihren Büros langweilen, weil sie keine Autos für Kontrollen haben. Ob man dem Papier trauen kann? "Irgendetwas muss man ja glauben", sagt Frank Oltersdorf, man könne ja nicht selbst nach Indien fliegen und die Betriebe überprüfen. Er beruft sich auf die rechtlichen Vorgaben, die seine Arbeit bestimmen: "Wir müssen bei einem öffentlichen Auftrag das wirtschaftlichste Angebot auswählen." Und ein vager Verdacht allein reiche nun mal nicht aus, um einen Bewerber vom Vergabeverfahren auszuschließen.
Die Verantwortung verwässert entlang der Handelskette
Mittlerweile hat die Bundesregierung das Vergaberecht dahingehend geändert, dass auch soziale Aspekte bei Ausschreibungen eine stärkere Rolle spielen können - indische Steinimporte sind seitdem zurückgegangen. Oltersdorf will bei künftigen Ausschreibungen stärker auf mögliche Missstände wie Kinderarbeit achten, "soweit das im Rahmen der rechtlichen Vorgaben geht", schränkt er ein.
Wahrscheinlich liegt darin das Problem: Die Verantwortung verwässert entlang der Handelskette. Sie verschwindet nicht, aber je mehr Produzenten, Händler, Exporteure, Lieferanten, Käufer, Gesetzgeber und Baudezernenten beteiligt sind, desto weniger fühlt sich der Einzelne zuständig. Zugleich nehmen die Möglichkeiten für jeden, die weitgehend akzeptierten Regeln der Branche zu ändern, ab.
Frank Oltersdorf steht am Ende der Lieferkette. Ob tatsächlich Kinder seine Steine hergestellt haben, wird er nie mit Sicherheit be- oder widerlegen können. Der Verdacht bleibt. Ebenso die Frage, wie er hätte Einfluss nehmen können auf das, was am Anfang passiert, in knapp 6000 Kilometern Entfernung. Und ob es einen Unterschied machen würde, wenn er anders gehandelt hätte. Er weiß natürlich auch: "Wenn wir die Steine nicht gekauft hätten, hätte es jemand anderes gemacht, vielleicht in China oder Australien."
Dieser Text stammt aus dem Magazin "enorm - Wirtschaft für den Menschen" / Von Johannes Pennekamp
^^^